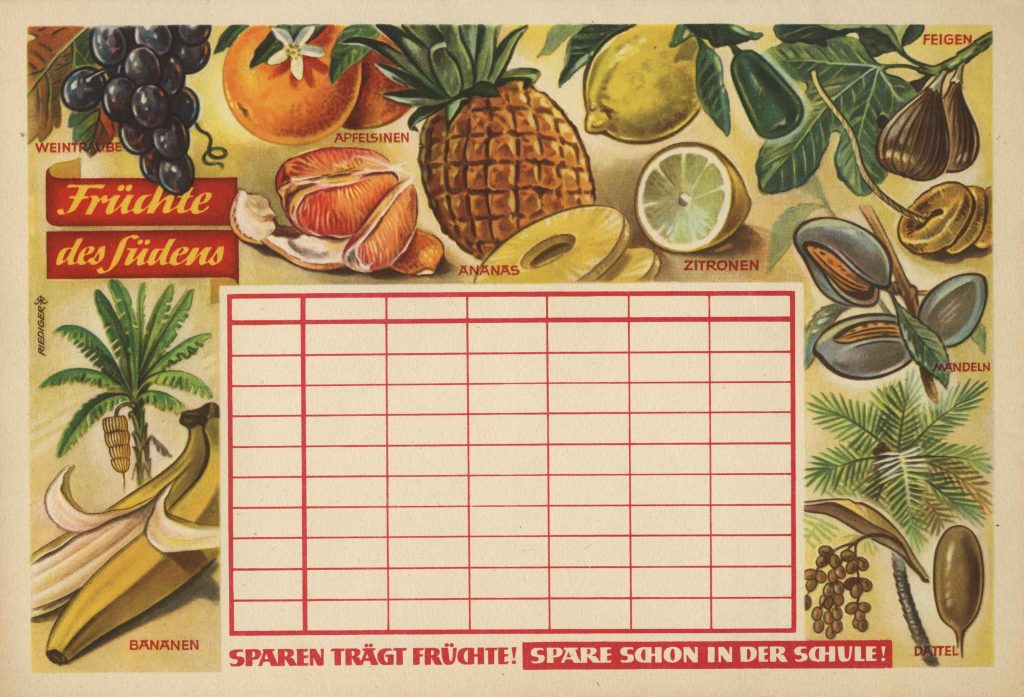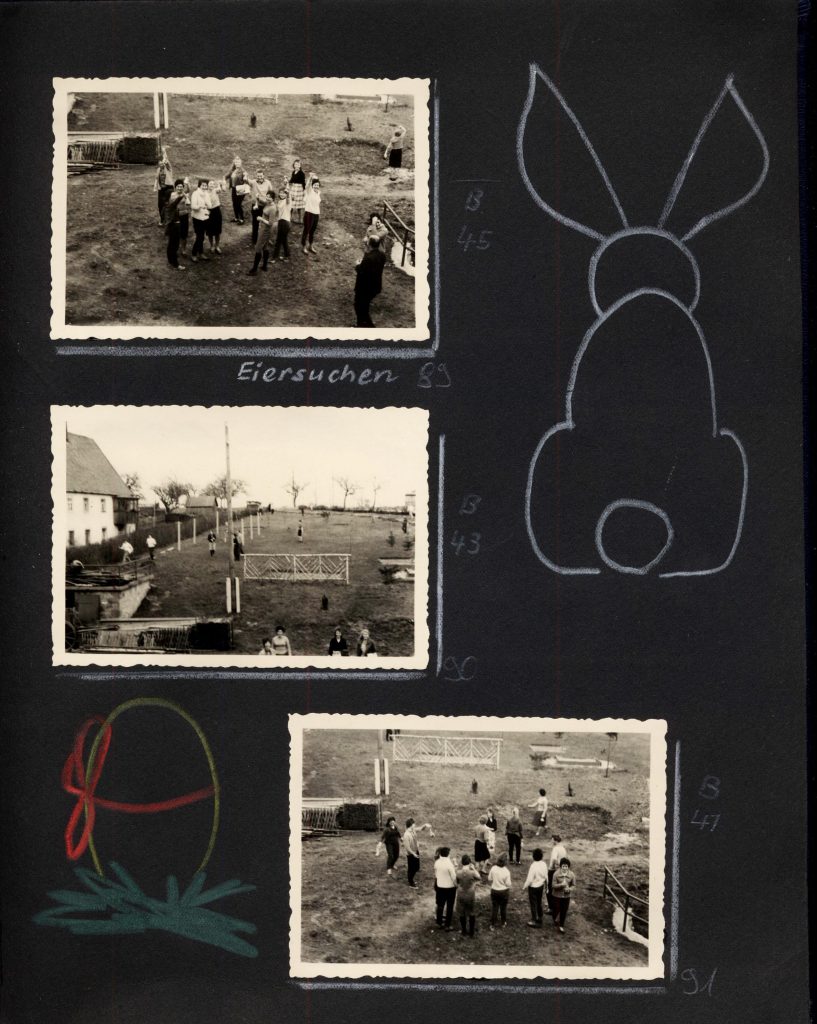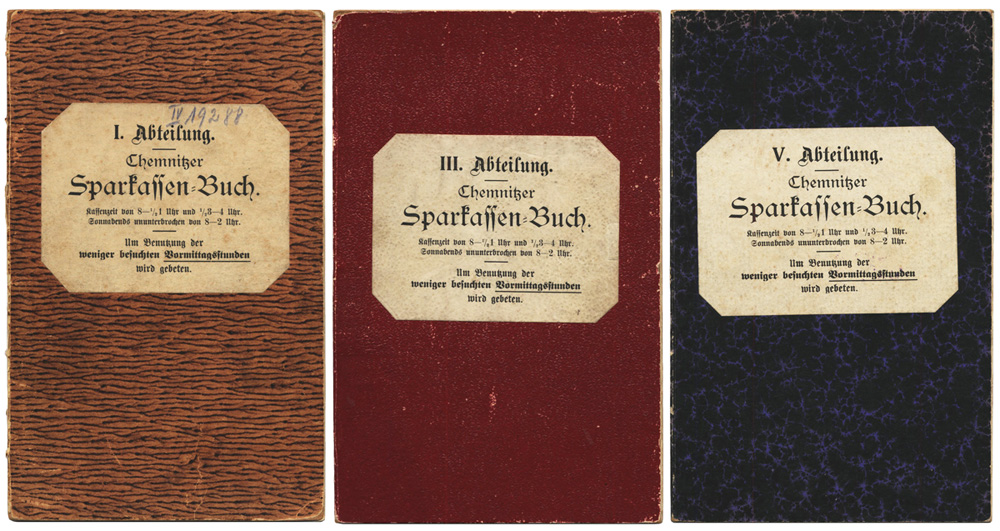Im letzten Beitrag mit dem Titel „Von Teeziegeln und Regenbogenschüsselchen“ haben Sie zuletzt die Kaurischnecken als Zahlungsmittel im westafrikanischen Raum kennengelernt. In Westafrika wurden jedoch nicht nur Kauris eingesetzt.
Manillen
Lange Zeit handelte man mit den „Manillen“, einem westafrikanischen Ringgeld aus legiertem Kupfer bzw. Bronze. Genau genommen hielt sich der kostbare Armreif noch bis ins Jahr 1948 als offizielles Zahlungsmittel bevor er von der britischen Kolonialverwaltung in Nigeria eingezogen und ab dem 01.04.1949 endgültig als Zahlungsmittel verboten wurde. Die Manillen, die einen nicht ganz geschlossenen Kreis bilden, tauchten in ganz unterschiedlichen Anfertigungen in verschiedenen Regionen Westafrikas auf und werden dem Barrengeld zugeordnet.
Dabei beherbergt das Historische Archiv des OSV gleich zwei Formen des geschichtsträchtigen Schmuckstücks: die Standard-Manille mit schlichter Gestaltung und ohne Verzierung ist der Prototyp des europäischen Imports. Eine weniger schlichte Variante ist auf einem weiteren Foto zu sehen. Diese leicht bräunlich wirkende Manille ist mit zahlreichen Ornamenten versehen und erinnert eher an ein Schmuckstück. Allerdings war dieses Exemplar mit einem Gewicht von über 1000 g weniger zum Tragen als vielmehr zum Bezahlen gedacht. Manillen wurden gern als Wertmesser innerhalb des Sklavenhandels eingesetzt. Für etwa 12 bis 15 Manillen war es bereits möglich einen Sklaven zu „erwerben“ [1]. Darüber hinaus nutzte man die Manillen auch als Brautgeld oder Grabbeigabe.
Paternostererbsen
Es gab jedoch auch Zahlungsmittel, denen neben einer Geldfunktion, auch ein Verbrauchswert innewohnte. So wurden zum Beispiel Kakaobohnen als Naturalgeld verwendet, die jedoch einen Nachteil hatten: ihr wahrer Wert zeigte sich erst, wenn man sie konsumierte, doch dann waren sie eben „weg“. Besser nicht konsumieren sollte man die Paternostererbsen. Die kleinen roten Hülsenfrüchte, die sehr an einen Marienkäfer erinnern, kamen in Süd-Nigeria und Kamerun, aber auch in Indien, dem Land aus dem sie stammen, als Zahlungsmittel seit dem Altertum zum Einsatz. In Indien, wo sie auch „Rati“ heißen, wurden und werden sie zudem zum Abwiegen von Gold benutzt, da ein Samen etwa einem Karat entspricht.
Circa 100 Stück der rot-schwarzen Erbsen kamen dem Wert eines Pennys gleich. In Afrika und Asien benutzte man die farbenprächtigen Samen zudem gerne für die Herstellung von Schmuckketten. Diese Art der Verwendung war in der Geschichte aber keinesfalls neu: bereits vor 400 Jahren entdeckten die Mönche die hochgiftigen Erbsen für sich und kreierten daraus ihre ganz speziellen Rosenkränze. Das in der Paternostererbse enthaltene Abrin ist ein pflanzliches Toxin, welches zu den tödlichsten Giften überhaupt zählt. Bereits 0,01 Mikrogramm pro Kilogramm können tödlich für einen Menschen sein [2]. Das Gift kann jedoch erst im zerkauten bzw. aufgebrochenen Zustand austreten, weshalb das Verschlucken einer unzerkauten Erbse nicht zwingend tödlich wäre.
Teeziegel
Weniger giftig und weitaus genießbarer ist der letzte Kandidat in der Riege der exotischen Zahlungsmittel vergangener Zeiten die im OSV-Archiv gesammelt werden. Denn neben mühsam hergestellten Glasperlen und kilogrammschweren Kupferarmbändern wurden nicht selten auch Lebensmittel als Warengeld verwendet. So kam der Teeziegel im 9. bis 20. Jahrhundert vor allem in China, Birma, Tibet, Turkmenistan, Sibirien, Russland und in der Monogolei als Zahlungsmittel auf. Der Wert der quaderförmig gepressten Teeblätter richtete sich dabei nach ihrem Gewicht und ihrer Qualität. Jedoch war die Qualität auch von der Farbe, dem Gärungsprozess und dem Verhältnis zwischen Zweigen und Teeblättern abhängig.
Der Teeziegel des OSV-Archivs stammt ursprünglich aus der Provinz Yunnan, in welcher die Stadt Pu’er zu finden ist. Die Stadt ist Namensgeber für die mittlerweile weltweit bekannte, chinesische Teesorte „Pu-Erh-Tee“. Bei der Wertbestimmung des Teeziegels gilt: je älter der Tee desto höher sein Wert. Aus diesem Grund lagerte man auch gerne die sogenannten „Pu-Erh-Ziegel“ für längere Zeit, um das angelegte Geld zu vermehren – das Geld trug sozusagen Zinsen ein. Der abgebildete Teeziegel trägt in der obersten Reihe fünf nebeneinandergereihte Sterne, während direkt darunter ein Tempel mit drei Portiken abgebildet ist. Im letzten, untersten Feld finden sich chinesische Schriftzeichen, die einen Hinweis auf die Herstellungsstätte geben. Es waren um 1900 übrigens etwa 12 bis 15 Teeziegel nötig, um ein Schaf in der Mongolei zu kaufen [3].
Celina Höffgen, Praktikantin Historisches Archiv des OSV
[1] Ostdeutscher Sparkassenverband: Geld[un]formen. Katalog zum gleichnamigen Wettbewerb und zur Wanderausstellung des Ostdeutschen Sparkassenverbandes. Berlin: Sparkassenverlag, 2008, S. 27
[2] Angelika Baack, geb. Zinner: Antikonzeptive und phytoöstrogene Wirkweisen bestimmter Gewürze, Heil- und Zierpflanzen sowie pflanzlicher Lebensmittel. Hamburg, Diplomica Verlag GmbH, 2007, S. 108
[3] Moneymuseum, Texte Hadlaub, „Traditionelle Zahlungsmittel“: Online im Internet: URL: https://www.moneymuseum.com/pdf/archiv/Traditionelle%20Zahlungsmittel,%20Texte%20Hadlaub.pdf [zuletzt aufgerufen am 14.03.2019]