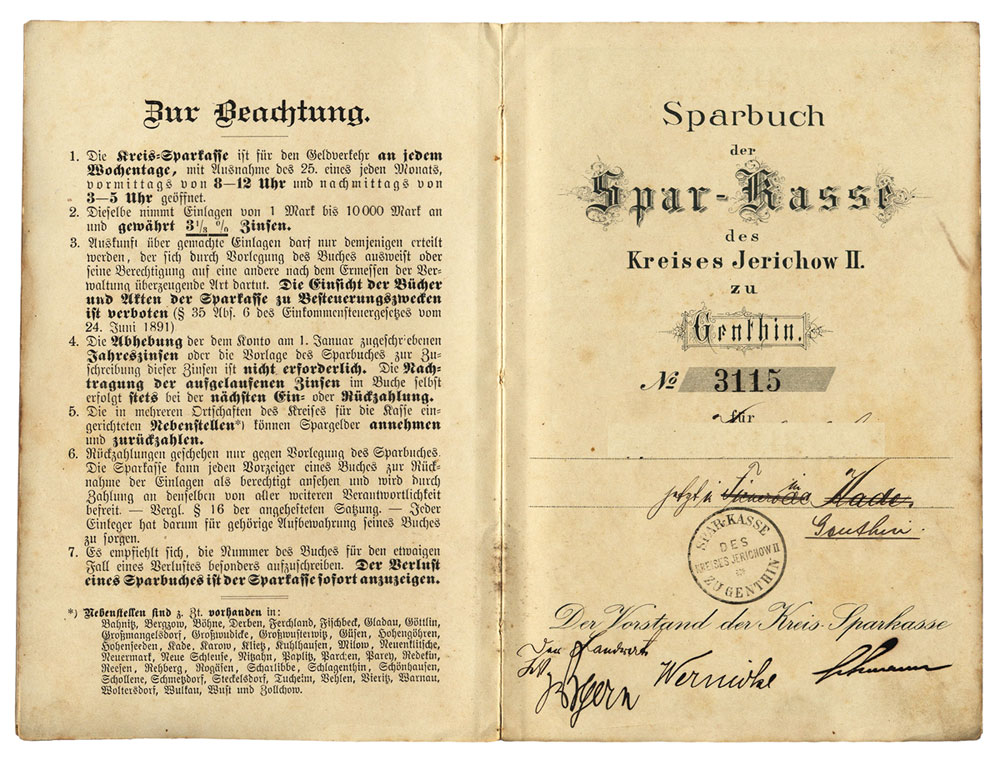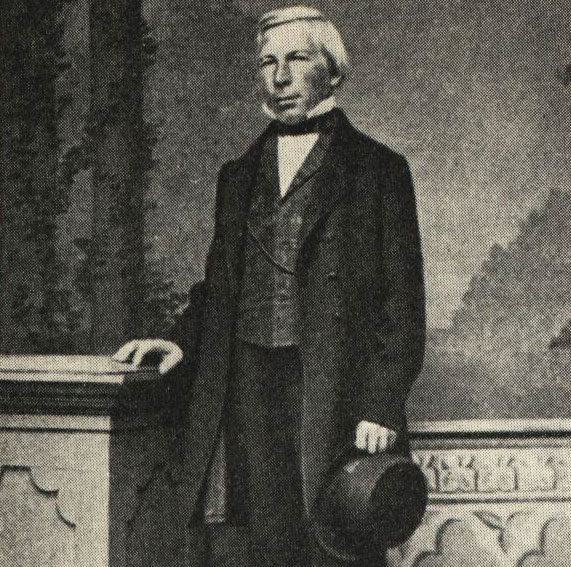„Eine beachtliche Beteiligung der Handweber an sonstigen Wohlfahrtseinrichtungen war nicht nachzuweisen; in Reichenau, Seifhennersdorf, Ostritz, Oderwitz, Grossschönau befinden sich communale Sparkassen, doch war nur in Grossschönau, wo die Löhne besser sind, eine größere Zahl Spareinleger Handweber, während an den anderen Orten die Weber zwar als sparsam bezeichnet werden, aber Nichts zu sparen haben.“*
Diese Zeilen schrieb 1885 der noch heute in der Region bekannte Zittauer Amtshauptmann Richard von Schlieben. Er hatte eine Untersuchung veranlasst, um die Lebensverhältnisse und die wirtschaftliche Lage der Handweber seines Verwaltungsbezirks genau kennen zu lernen und ihr ärmliches Leben verbessern zu können. Von Schlieben wollte herausfinden, ob sie sich die Bismarck’sche Krankenversicherung leisten konnten.
Die Handweber arbeiteten am Webstuhl in ihrem Zuhause. Frau und Kinder halfen bei der Fertigung mit. Hergestellt wurde zum Beispiel Damast. Dafür war Großschönau berühmt. Auch die im folgenden Fragebogen dargestellte Familie verdiente damit Geld. Wie ihre Lebenswirklichkeit aussah und ob sie tatsächlich etwas zum Sparen übrig hatte, können Sie anhand der überlieferten Aussagen selbst feststellen. Die damalige Schreibweise wurde beibehalten.
Fragebogen zur Ermittelung der Lebenshaltung einer Weberfamilie in Grossschönau
Alter des Mannes? 61 Jahre; Alter der Frau? 41 Jahre; Zahl der Kinder? 4; im Alter von 12, 10, 7, 2 Jahren
Aus welchen Räumen besteht die Wohnung? 1 Stube, 1 Kammer, 1 Bodenraum, 1 Kellergelass
Welche Nahrungsmittel sind die hauptsächlichsten? Brod oder Kartoffeln oder Gemüse und Mehl? Brod, Kartoffeln, Mehl
Wie oft in der Woche besteht die Tagesmahlzeit aus Fleischspeisen? Welches Fleisch (Rind- oder Schweinefleisch) hat den Vorzug? Nur sonntags ½ Kilo Rindfleisch
Die Ausgaben für den Lebensunterhalt betragen pro Woche?
Brod 21 Kg (7 Stck.) = 4 Mark
Weizenmehl 1 Kg = 40 Pfennige
Roggenmehl 1/2 Kg = 14 Pfennige
Kartoffeln (theils erbaut, theils gekauft) 12 1/2 Liter = 67 Pfennige (10 Ctr. um 35 Mark gekauft)
Gemüse (Erbsen, Linsen, Bohnen, Reis etc.) —
Kaffee (Nur sogenannten Gesundheitskaffee) = 4 Pfennige
Cichorien —
Zucker —
Semmel —
Milch, 3 Ziegen werden gehalten — (Es wurden Käse verkauft u. 35 Mark eingelöst.)
Eier 3 Stck. = 15 Pfennige
Butter 1/2 Kg = 1 Mark 10 Pfennige
Fett —
Quark 1/4 Kg = 10 Pfennige
Speck 1/2 Kg = 65 Pfennige
Fleisch 1/2 Kg = 56 Pfennige
Fische (Heringe) 2 Stck. = 20 Pfennige
Salz 1 Kg = 18 Pfennige
Pfeffer und anderes Gewürz = 2 Pfennige
Seife 1/8 Kg = 11 Pfennige
Stärke 1/4 Kg = 10 Pfennige
Soda = 3 Pfennige
Petroleum 1 1/2 Kg = 33 Pfennige (durchschnittlich)
Rüböl = 2 Pfennige
Talglichte —
Summa 8 Mark 80 Pfennige
mal 52 Wochen = 457 Mark 60 Pfennige
Hierzu:
Wohnungsmiete pro Jahr? Das Haus ist Eigenthum, Schuldzinsen zu zahlen = 75 Mark
Kleidung pro Jahr (Schumacher und Schneider, Wäscheartikel, Zwirn, Band etc.) = 50 Mark
Kohlen und Holz pro Jahr? 70 Ctr. Kohlen und 3 Meter Holz = 50 Mark
Kochgeschirr und Küchengeräth etc. pro Jahr = 6 Mark
Schulgeld pro Jahr und Schulbedürfnisse = 21 Mark 60 Pfennige
Staatssteuern pro Jahr = 1 Mark
Gemeindesteuern pro Jahr = 2 Mark 25 Pfennige
Beiträge für Lebensversicherung, Krankenversicherung, Vereine (Militär-, Turnverein) —
Ausgaben für Vergnügungen, Bier ausser dem Hause, Tabak etc. = 15 Mark
Kleie als Ziegenfutter um 45 Mark und Reparatur des Hausdaches 45 Mark, Schlichte, 2 Bürsten 11 Mark = 101 Mark
Gesammtausgabe: 779 Mark 45 Pfennige
Wie viel verdiente durch Handweberei der Mann? 337 Mark 76 Pfennige
Die Frau und 2 Kinder beschäftigten sich mit Mustereinbinden und spulen.
Wie viel verdiente die Familie durch den Betrieb eines noch anderen Gewerbes? 415 Mark im Jahre 1884 durch Mustereinbinden laut Lohnbuch; 35 Mark Erlös aus Ziegenkäsen
Wie gross ist das von der Familie bebaute Feldgrundstück? 27,7 Ar Feld, 14 Ar Wiese
Welche Fruchtgattungen werden darauf gebaut? 1884 wurden 5 Ctr. Kartoffeln gebaut (etwas Missernte), Gras zur Fütterung der Ziegen
Wie heissen die Factore bezw. Fabrikanten, für welche die Familie arbeitete? W. & S. in Grossschönau
Welche Waaren wurden gewebt? 3 ½ Elle breiter Damast
Wie ist die Arbeitszeit? Anfang früh 6 Uhr, im Winter 8 Uhr; Ende abends 7 Uhr, im Winter 10 Uhr
Wie lange dauert die Mittagspause? 1 Stunde
Welche Baarauslagen entstehen bei der Weberei (für Schlichte, Bürsten etc.)? Jahresbetrag: 11 Mark; wöchentlich ½ Pfund Mehl [für Schlichte, d.A.], 2 Paar Bürsten
* Richard von Schlieben: Untersuchungen über das Einkommen und die Lebenshaltung der Handweber im Bezirke der Amtshauptmannschaft Zittau, in: Zeitschrift des Statistischen Bureaus des
Königlich Sächsischen Ministeriums des Inneren, 1885, S. 165